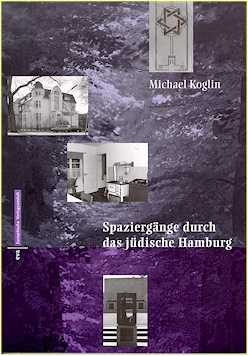 Spaziergänge durch
das jüdische Hamburg Spaziergänge durch
das jüdische HamburgDas Hamburger Grindelviertel, irgendwann in den zwanziger
Jahren. Durch die Luft zieht der Geruch nach Ingwer und Salbei. Aus den Küchenfenstern
duftet es nach gefillte Fisch oder nach Lokschen auf salzige Art mit Hammelfleisch.
In diesem Stadtteil begegnen die in Hamburg geborenen Juden ihren Glaubensbrüdern aus
Osteuropa, Christen und Juden kaufen gemeinsam in den zahlreichen koscheren und nicht
koscheren Läden. Es wird jiddisch gesprochen, polnisch oder hochdeutsch. Das
Grindelviertel ist ein quicklebendiges Stück Hamburg.
Viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren nach dem Wegfall der Torsperre im Jahr 1860
von der Neustadt hierher in die gerade aufblühenden Stadtteile Rotherbaum und
Harvestehude gezogen.
Von diesem quirligen Leben ist nach der Shoah, dem Holocaust, kaum etwas geblieben.
1931 lebten 20.000 Juden in Hamburg, weitere 5.000 waren in Altona beheimatet. 1939, nach
Jahren der Demütigung und Verfolgung durch die Nazis, bestand die jüdische Gemeinde nur
noch aus 8.400 Mitgliedern. Ab 1941 setzten die Deportationen ein. Mehr als 8000 Hamburger
Juden wurden in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten, in Auschwitz, Treblinka
oder Neuengamme ermordet.
Die Synagogen, Schulen und anderen Stätten jüdischen Lebens wurden zweckentfremdet,
abgebrannt, niedergerissen oder ausgebombt. Geblieben sind nach dem Ende der
Naziherrschaft nur wenige Gebäude und ein paar Mauern.
Aus dem Tempel wurde ein Rundfunkstudio, aus der Synagoge ein Autogarage, aus einer Schule
ein Kindertagesheim.
Dieses Buch möchte die Leser in diese heute noch vorhandenen Gebäude begleiten, von
ihrer Geschichte und Bedeutung für die jüdische Bevölkerung erzählen. Es wendet sich
besonders an jene Leser, die noch nichts oder nur wenig vom einstigen jüdischen Leben am
Grindel wissen.
Bei meiner Arbeit haben mir nicht nur die steinernen Zeitzeugen geholfen. Auch aus den
Erinnerungen von ehemals in Hamburg beheimateten jüdischen Mitbürgern habe ich
zahlreiche Anregungen erhalten. Ebenso durch den Landesrabbiner Dov-Levy Barsilay, den
Kantor Arieh Gelber und die Vorsitzende der Deutsch-Israelitischen Gesellschaft Waltraut
Rubien. Ihnen möchte ich an dieser Stelle ebenso herzlich danken wie denjenigen
Forscherinnen und Forschern, die in jahrzehntelanger mühevoller Arbeit die Erinnerung an
das einst auch in Hamburg blühende jüdische Leben wachgehalten haben.
Zahlreiche Informationen und Forschungsergebnisse sind in dieses Buch eingeflossen.
Stellvertretend möchte ich nennen: Manfred Asendorf, Maike Bruhns, Ursula Büttner, Peter
Freimark, Erika Hirsch, Ursel Hochmuth, Gertrud Meyer, Helga Krohn, Reiner Lehberger,
Astrid Louven, Mary Lindemann, Ina Lorenz, Günter Marwedel, Christiane Pritzlaff, Ursula
Randt, Irmgard Stein, Charlotte Ueckert-Hilbig, Harald Vieth, Ursula Wamser und Wilfried
Weinke.
Nicht denkbar wäre dieser Rundgang ohne die Lebenserinnerungen von Arie Goral,
Miriam Gillis-Carlebach, Heinz Liepmann und Justin Steinfeld.
Ich würde mich freuen, wenn dieser Spaziergang durch die jüdischen Baudenkmäler auch
ein Anstoß sein könnte, etwas offener auf jene Menschen zuzugehen, die heute auf ihrer
Flucht ein Asyl in Hamburg erhalten haben. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in
der sich wieder der Antisemitismus und Fremdenhass in einigen deutschen Hirnen
festzukrallen droht.
Auch die Menschen, die heute in dieser Stadt Zuflucht suchen, stellen eine Bereicherung
unseres Lebens und unserer Kultur dar. Auch ihr Leben in dieser Stadt können wir als ein
Geschenk begreifen. Es kommt zunächst einmal darauf an, nicht ab- und auszugrenzen,
sondern: Zu Verstehen. |
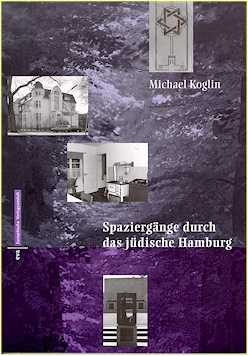 Spaziergänge durch
das jüdische Hamburg
Spaziergänge durch
das jüdische Hamburg